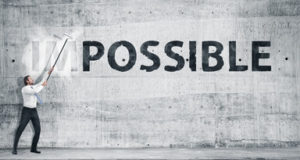langfristige Anlage von Kapital in Sachgütern. Die Gesamtheit der einer Periode wird Bruttoinvestition genannt, der Teil der Bruttoinvestition, der zur Erhaltung bzw. zum Ersatz der verbrauchten Teile des Produktionsapparats dient, wird Erhaltungs-, Ersatz-oder Reinvestition genannt. Erweiterungs- oder Nettoinvestition heißt derjenige Teil, der zur Erweiterung des Produktionsapparats dient. I. in dauerhafte, sachliche und reproduzierbare Produktionsmittel sind Anlageinvestitionen. I. in Bestände sind Lager- oder Vorratsinvestitionen. In der Investitionsstatistik wird bei den Anlageinvestitionen ...
Read More »G H I
Gemeinlastprinzip, Gemeinnützigkeit, Gemeinsamer Markt und Gemeinschaftsteuer – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste
Gemeinlastprinzip Leitlinie in der Umweltpolitik, nach der im Gegensatz zum Verursacherprinzip die Kosten, die mit der Vermeidung oder der Beseitigung von Umweltschäden verbunden sind, der Allgemeinheit angelastet werden. Angewendet wird das G. beispielsweise bei öffentlichen Kläranlagen oder Mülldeponien. – Siehe auch Umweltökonomie. Gemeinnützigkeit eine auf die selbstlose Förderung der Allgemeinheit ausgerichtete Tätigkeit. Körperschaften, die ausschließlich gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen, sind von der Körperschaft-, Vermögen- und Gewerbesteuer befreit. Spenden ...
Read More »HV, Haushalt, Haushaltsdisziplin und Haushaltsfreibetrag- und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste
Hauptversammlung, HV wesentliche Einrichtung (Organ) bei einer AG, zu der alle Aktionäre mit Stimmrecht gehören. In der HV beschließen die Aktionäre im Wesentlichen über • die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner, • die Verwendung des Bilanzgewinns, • Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen, • die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Haushalt in der Volkswirtschaft Wirtschaftseinheiten, die im Gegensatz zu Unternehmen Güter zur Bedürfnisbefriedigung konsumieren (private Haushalte). Das Wirtschaften der privaten H. wird im ...
Read More »Geldschöpfung und Geldtheorie – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe
Geldschöpfung die Vermehrung der Geldmenge durch Schaffung von zusätzlichem Geld. Unterschieden wird die Bargeldschöpfung durch die Ausgabe von Banknoten und Münzen und die Giralgeldschöpfung über das Bankensystem (Gegenteil: Geldvernichtung). Der Prozess der Giralgeldschöpfung erfolgt über die Erhöhung der Menge an Giral- oder Buchgeld (Geld auf Konten), da die Banken Geld ihrer Kunden, das auf Giro- oder Sparkonten gutgeschrieben ist, nicht im Tresor aufbewahren, sondern zum überwiegenden Teil dazu benutzen, als ...
Read More »Handelsgesellschaft, HGB und Handelshemmnis – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe
Handelsgesellschaft Gesellschaft, für die die Vorschriften über Kaufleute gelten, weil sie entweder ein Handelsgewerbe betreibt (OHG, KG) oder weil das Gesetz ihr ohne Rücksicht auf den Gegenstand ihres Unternehmens die Kaufmannseigenschaft beilegt (AG, KgaA, auch GmbH). Handelsgesetzbuch, HGB regelt das deutsche Handelsrecht und ist als Allgemeines Deutsches Handelsrecht seit 1861 in Kraft, 1897 durch Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) geändert und in neuer Fassung am 1. 1. 1990 gemeinsam mit ...
Read More »Geschichte des Geldes – und die Bedeutung davon – Wirtschaftsbegriffe Übersicht
Geschichte des Geldes Schon sehr früh wurden Gegenstände als Tauschmittel und Wertmaßstab stellvertretend für alle anderen Güter als sog. Natural- oder Warengeld eingesetzt. So finden sich bei den Höhlenbewohnern Westeuropas bereits um 25 000 v.Chr. kleine Äxte aus Jade, die als eine Art Geld benutzt wurden. Nach verwendetem Material und dem Abstraktionsgrad, der mit dem Entwicklungsstand einer Gesellschaft zunimmt, lassen sich folgende Gruppen unterscheiden: Steingeld, Ring- und Zahngeld, Schmuckgeld, Kleidergeld, ...
Read More »Homebanking, Homo oeconomicus und Humanisierung der Arbeit – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste
Homebanking Bankgeschäfte, die mithilfe eines Computers und eines Internetzugangs von zu Hause aus abgewickelt werden können. Um eine hohe Sicherheit während der Übertragung der Daten zu gewährleisten, werden verschiedene Sicherheitssysteme eingesetzt: Meist meldet sich der Kunde über eine Personalidentifikationsnummer (PIN) am Banksystem an und legitimiert jeden Auftrag über eine Transaktionsnummer (TAN), die er von der Bank bekommen hat. Daneben etabliert sich zz. der HBCI-Standard, der mittels einer Chipkarte den login ...
Read More »Güterklasse, Guter Glaube und Güterverkehrszentren – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste
Güteklasse Information der Verbraucher über die Qualität von Eiern, Obst und Gemüse, die als EU-Normen verbindlich sind. Bei Eiern gibt es die G. A, B und C; bestimmte Merkmale (Schale, Eiweiß, Dotter, Geruch) spielen die wichtigste Rolle für die Einordnung. Die G. für Obst und Gemüse reichen von Extra (höchste Qualität) bis II (marktfähige Qualität). Guter Glaube bei einer Rechtshandlung die Überzeugung eines Beteiligten vom Vorhandensein eines in Wirklichkeit fehlenden ...
Read More »Geldillusion, Geldmarkt und Geldmarktpapier – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste
Geldillusion Begriff der Geldtheorie. G. liegt vor, wenn sich Personen oder Einrichtungen in ihrem wirtschaftlichen Verhalten nicht nach dem realen Wert des Geldes richten, sondern an dessen nominalem Wert orientieren. Der G. unterliegt beispielsweise ein Arbeitnehmer, der eine Erhöhung seines Nominallohns von 5 % zum Anlass nimmt, seine Nachfrage nach Konsumgütern zu steigern, obwohl die Preissteigerungsrate ebenfalls 5 % beträgt. Geldmarkt im engeren Sinn ein Markt für Zentralbankgeld und notenbankfähige ...
Read More »Moderne Geldarten – und die Bedeutung davon – Wirtschaftsbegriffe Übersicht
Moderne Geldarten – Wirtschaftsbegriffe Übersicht Beim heutigen Geld wird zunächst zwischen Bargeld und Buch-geld unterschieden. Unter Buchgeld – auch Giralgeld genannt – werden die jederzeit fälligen Guthaben bzw. Sichteinlagen auf Girokonten bei Banken verstanden, über die Kunden mit Scheck, Überweisung oder Barabhebung verfügen können. Das Bargeld teilt sich auf in Banknoten und Münzen. Banknoten waren ursprünglich kein Zahlungsmittel, sondern lediglich ein Versprechen der Bank, gegen Vorlage der Note Münzgeld auszuzahlen. ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen