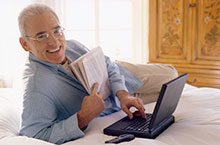Basketzertifikate beinhalten eine mitunter recht kreative Auswahl von Aktien, meist verbunden mit einer bestimmten Thematik. Dabei kann es um Übernahmekandidaten gehen, die besondere Kurszuwächse versprechen, um spezielle Branchen wie Generikahersteller oder Energiefirmen und Ähnliche. Manchmal handelt es sich um Modeerscheinungen, manchmal steckt aber auch wirklich etwas Fundamentales dahinter. Zu unterscheiden sind statische und dynamische Baskets: • Beim statischen Basket wird anfangs festgelegt, welche Wertpapiere (in der Regel Aktien) enthalten sind. ...
Read More »Tag Archives: beste geldanlage
Crashs und Trends an den Börsen – Risiken der Geldanlage
Alles Wissen um das Funktionieren der Börsen hilft nicht, Turbulenzen zu verhindern. Denn wenn man sich ansieht, wie sich die Menschen an den Börsen verhalten, dann ist das eher mit Autofahren auf einer vereisten Autobahn zu vergleichen als mit einem geregelten und vor allem vernünftigen Verhalten. So geraten die Marktteilnehmer gelegentlich in Panik, wenn das Wirtschaftswachstum abflaut, weil ja theoretisch bei allen Unternehmen gleichzeitig die Gewinne einbrechen könnten; aber auch, ...
Read More »Express-Zertifikate richtig verstehen – für die schnelle Gewinnmitnahme oder das lange Warten
Recht großer Beliebtheit erfreuen sich die Express-Zertifikate. Auf den ersten Blick sind sie leicht zu verstehen und man kann ihr Funktionsprinzip so deuten, dass für jeden Anleger immer etwas Gutes herauskommt. Wundermittel sind sie aber auch nicht. Vor allem ist die tatsächliche Laufzeit zu Beginn nicht bekannt. Das Konzept ist Folgendes: Über eine festgelegte, längere Laufzeit wird im Jahresabstand geprüft, ob der Kurs des Basiswerts (Aktie/ Index) über der Tilgungsschwelle ...
Read More »Geldanlage leicht gemacht – das Ebenenkonzept der Geldanlage
Am Schluss des Artikels stellt sich natürlich die Frage, wie man aus all den Ideen und Möglichkeiten ein sinnvolles Depot zusammenstellt. Wenn Sie noch einmal an das Artikel über Vermögensberater denken [Artikel 4], dann wissen Sie, dass neben den Interessen der Anleger und den vorhandenen Produkten auch die Marktsituation zu berücksichtigen ist. Diese ändert sich aber häufig im Monatsrhythmus, so dass grundsätzliche Empfehlungen für die Depotstruktur immer unter dem Marktvorbehalt ...
Read More »Mit Puffer nach unten und ohne Grenze nach oben – Bonuszertifikate richtig verstehen
Discountzertifikate funktionieren schlecht in Zeiten geringer Volatilität und hoher Kursgewinne. Die eingebaute Obergrenze schneidet nämlich Gewinne ab, die über ein festgelegtes Niveau hinausgehen. Wenn sich die Märkte stark positiv entwickeln, haben die Discount-Anleger das Nachsehen. Um den weniger risikofreudigen Anlegern ein attraktives Zertifikat anbieten zu können, wurden deswegen die Bonuszertifikate entwickelt. Sie funktionieren ganz anders, passen aber zu der gleichen Einstellung zum Markt. Hier werden aber die Dividenden genutzt, um ...
Read More »Möglichkeiten zur Begrenzung des Risikos – Risiken der Geldanlage
Inzwischen wissen Sie einiges über die unterschiedlichsten Arten von Wertpapieren, können sie beurteilen, kaufen und verkaufen – es fehlt aber noch etwas Strategiebewusstsein. Das kann man nicht unbedingt in einem Buchkapitel vermitteln, man kann aber die nötigen gedanklichen Prozesse anstoßen. Auch bei größtem Engagement werden Sie nicht innerhalb von Monaten zum Anlageprofi werden. Man sagt über Fondsmanager zum Beispiel, dass sie erst eine Auf- und eine Abschwungphase heil überstanden haben ...
Read More »Welche Zertifikate für welchen Anleger und welchen Markt geeignet sind
Zwar können hier nicht alle individuellen Wünsche und Marktsituationen berücksichtigt werden, einige allgemeine Hinweise lassen sich aber schon geben. Allgemeine Hinweise für den Kauf von Zertifikaten: 1. Vergewissern Sie sich vorher, dass Sie den Mechanismus verstanden haben. Sehen Sie sich gegebenenfalls als Grafik oder Musterrechnung einen besonders guten und einen besonders schlechten potenziellen Kursverlauf an, so dass Sie über Verlustrisiken und gegebenenfalls Gewinngrenzen informiert sind. 2. Wenn Ihnen Zertifikate von ...
Read More »Wissen die Experten mehr Börseninfo als die anderen Leute über Aktien usw
Kann man denn eigentlich den Prognosen der Experten für die Entwicklung der Indizes vertrauen? Eigentlich sollte man meinen, Vertreter von Banken verfügten über ein besonders inniges Verständnis der Märkte. Konsequenterweise werden sie auch regelmäßig zu ihren Einschätzungen befragt, was immer wieder ein gern gelesener Beitrag in der einschlägigen Presse ist. Sieht man sich die Ergebnisse an, könnte man aber eher verzweifeln. Nicht, dass es nie stimmt, was da prognostiziert wird. ...
Read More »Anlagemöglichkeiten außerhalb Deutschlands – hilfreiche Information
Was ich nicht kenne, esse ich nicht. Trifft das auf Sie zu? Falls ja, dann sollten Sie für alle Anlagefragen umdenken. Leider interessieren sich zu viele Anleger nur für das, was sie kennen beziehungsweise was sie zu kennen glauben. Und das sind dann die Produkte aus der Heimat. So vertrauen Deutsche den deutschen Staatsanleihen mehr als den französischen, kaufen Schweizer gerne Aktien Schweizer Unternehmen, weil sie häufiger mit ihnen zu ...
Read More »Outperformance-Zertifikate richtig verstehen – das Papier für Optimisten
Während die bisher vorgesteilten Zertifikate vor allem auf Risikominderung ausgerichtet waren und sich auch für stagnierende oder geringfügig fallende Märkte eigneten, kommen Outperformance-Zertifikate in steigenden Märkten zum Tragen. Sie eröffnen die Möglichkeit, an Kurssteigerungen mit einem Hebel zu partizipieren, ohne gleichzeitig das Risiko nach unten zu erhöhen. Was kostet mich das? werden Sie sicher fragen. Wie so oft lautet die Antwort: die Dividende. Durch den Verzicht auf die Dividende kaufen ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen