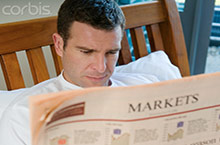Vor dem Kauf über Chancen und Risiken informieren Welche Chancen und Risiken eine Option beinhaltet, ist abhängig von vielen verschiedenen Faktoren. Eine wichtige Rolle spielt die Restlaufzeit ebenso wie der Zustand der Option und natürlich das Underlying. Um Anlegern die Kaufentscheidung zu erleichtern, sind im Laufe der Jahre die unterschiedlichsten Kennzahlen entwickelt worden. Doch längst nicht alle haben sich bewährt. Viele Kennzahlen besitzen – obwohl sie in der Praxis regelmäßig ...
Read More »Tag Archives: binäre optionen handeln
Wieso mit Optionen handeln
Es gibt gute Gründe für den Handel mit Optionen Der Handel mit Optionen boomt. Die Umsätze haben Höchststände erreicht und man kann beobachten, dass das Interesse vor allem bei Privatanlegern immer stärker zunimmt. Allein in Deutschland waren im Juli 2000 über 13.000 verschiedene Optionsscheine – eine spezielle Form von Optionen, auf die wir nachher noch ausführlich eingehen – im Umlauf. Zwei Jahre vorher lag die Zahl der Emissionen noch bei ...
Read More »Optionsscheine am PC handeln
Zur Erteilung einer Optionsscheinorder via Internet, führt der Weg über eine Kaufmaske auf der Website der Online-Bank. Natürlich kann nicht jeder, der auf die Seite der Bank gelangt, automatisch diese Eingabemaske aufrufen. Erforderlich ist zunächst die Schaffung einer sicheren Verbindung zwischen Bank und Anleger. Der Kunde benötigt dafür seine Kundennummer – oder alternativ Konto- oder Depotnummer – und eine Persönliche Identifikations- Nummer (PIN). Diese gibt er in dafür vorgesehene Felder ...
Read More »Wie Optionen bewertet werden können
Auf Mathematik kann verzichtet werden Im ersten Teil haben wir bereits gesehen, dass Optionen nicht kostenlos zu haben sind, Wer das Recht haben möchte, in der Zukunft eine Aktie zu einem heute festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, muss dafür einen Preis – oder besser die Optionsprämie — zahlen Der Schreiber ist an einem hoben, der Käufer natürlich an einem möglichst geringen Optionspreis interessiert. Doch wo hegt der richtige ...
Read More »Für Liquidität beim Optionshandel sorgen die Emittenten
Damit für jeden Optionsschein auch ein Markt vorhanden ist – also stets ge- und verkauft werden kann — stellen die Emittenten selbst laufend An- und Verkaufskurse, zu denen sie handelsbereit sind. Sie machen sozusagen den Markt und werden deshalb auch Market- Maker genannt. Unabhängig davon, ob lediglich Käufer bzw. Verkäufer oder überhaupt keine Handelsinteressenten vorhanden sind, stellt ein Market-Maker beidseitig, das heißt sowohl An- als auch Verkaufskurse. Derjenige Preis, zu ...
Read More »Szenario-Rechner von Börse Now
Auch die auf Optionsscheine spezialisierte Zeitschrift Börse Now bietet im Internet einen Szenario-Rechner an. Er verfügt im Grunde über dieselben Funktionen wie das Tool von OnVista, ist jedoch etwas anders aufgebaut und bietet dem Anleger die Möglichkeit, mehrere Szenarien gleichzeitig zu betrachten. Dargestellt werden die Ergebnisse der Analyse als Matrix, man könnte auch sagen in Tabellenform. Folgender Weg führt zu dem Szenario-Rechner: In diverse Webseiten könnte man wählen die Kategorie ...
Read More »Chat und Newsboard Forum für Optionshandel
Auch die Meinung anderer kann für die eigene Anlageentscheidung manchmal hilfreich sein. Bevor es das Internet gab, waren die Möglichkeiten stark eingeschränkt, einen geeigneten Partner für die Diskussion über die zukünftige Entwicklung einer Aktie oder eines Marktes zu finden. Dies hat sich inzwischen jedoch drastisch geändert. Dank Chats und Foren kann im Grunde jeder Anleger zu jeder beliebigen Zeit mit jedem anderen Online-Investor weltweit in Kontakt treten, um Fragen zu ...
Read More »Einfluss der Preisfaktoren im Überblick
Wir haben die Ergebnisse in einer Übersicht noch einmal zusammengefasst. Man erkennt, dass einige Faktoren auf Calls einen genau entgegengesetzten Werteinfluss haben wie auf Puts, während die Änderungen anderer Parameter auf beide Optionsarten die gleiche Wirkung haben. ln der Realität kann man beobachten, dass sich off mehrere Risikofaktoren gleichzeitig ändern und die Effekte sich daher überlagern. Steigen die Zinsen und geht gleichzeitig die Volatilität zurück, verstärken sich die Wirkungen. Ein ...
Read More »Implizite Volatilitäten im Internet
Historische Daten sind nicht die einzige Alternative, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie Aktienkurse (oder Devisenkurse und Zinssätze) in Zukunft schwanken könnten. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Optionspreisen, die in der Praxis tatsächlich zustande gekommen sind. Durch entsprechende Rechenschritte lässt sich herausfinden, auf welchen Volatilitäten diese Preise beruhen. Bildlich gesprochen setzt man die Formel von Black/Scholes mit dem Optionspreis gleich und löst die Gleichung dann nach der ...
Read More »Wie viel Verlust kann beim Handel von Optionen verkraftet werden
Neben der Bereitschaft Risiken zu übernehmen und Zeit zu opfern, sollte jeder Anleger auch überprüfen, ob er auftretende Verluste finanziell vertragen kann. Die Antwort ist nicht nur von der aktuellen Vermögenssituation abhängig, sondern auch von den absehbaren zukünftigen Verpflichtungen. Wird das eingesetzte Kapital bereits kurze Zeit später wieder benötigt, sollten Anleger keine hohen Risiken eingehen. Da bei Optionen immer mit extremen Wertschwankungen gerechnet werden muss, darf man nur so viel ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen