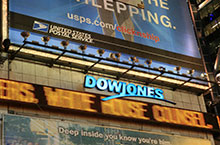Solche Kuriosa wie die Rocksaum-Theorie zeigen auch auf, welche Gefahren mit solchen Analysen verbunden sind. Das Data Mining, die systematische Durchforstung großer Datenberge, führt dazu, dass immer mehr Zusammenhänge erkannt werden. Es ist so, als würde jemand einen Heuhaufen minutiös durchwühlen und statt der berühmten Stecknadel gleich ein ganzes Sortiment an Nadeln finden. Das Problem beim Data Mining ist, dass niemand genau sagen kann, ob es sich bei diesem Zusammenhängen ...
Read More »Tag Archives: deutsche aktien
Die technische Analyse beim Aktienhandel verstehen
Die technische Analyse untersucht nur den Aktienkurs und betrachtet dessen Verlauf. Hierzu bedienen sich die Techniker des Charts; der englische Begriff bedeutete ursprünglich „Seekarte“ und meint ein Diagramm oder eine Grafik. Aktiencharts gibt es in den unterschiedlichsten Ausprägungen, und viele Finanzportale ermöglichen es Ihnen, die verschiedensten Charts zu erzeugen. Sie können den Kursverlauf einer Aktie 3 oder 5 Jahre zurückverfolgen und zusätzlich einen Index einblenden, der die Wertentwicklung des gesamten ...
Read More »Anlagestrategien in der Praxis beim Aktienkauf
Als Leser möchten Sie nun sicher wissen, wie man konkret solche Anlagestrategien umsetzen kann. Als erstes sollten Sie beachten, dass es keinen Sinn macht, solche Aktien selbst zusammenzustellen. Das wäre viel zu umständlich und zeitaufwändig. Viel bequemer und einfacher ist es, ein Zertifikat zu kaufen. Ein Zertifikat ist eigentlich eine Schuldverschreibung oder Anleihe einer Bank, die an die Wertentwicklung eines bestimmten Aktienkorbs gekoppelt. Die Experten der Bank führen für Sie ...
Read More »Anlagestrategien für Aktionäre richtig verstehen
Noch in den 1970er Jahren waren die meisten Wissenschaftler der Auffassung, dass es unmöglich sei, langfristig den Aktienmarkt zu übertreffen. Die meisten Anleger würden nur eine Durchschnittsrendite erzielen, die der Wertentwicklung des Gesamtmarkts entspricht. Deshalb plädierte man damals dafür, die sicherste und zuverlässigste Art, Geld anzulegen, sei ein Indexinvestment. Wenn man den Index eines Gesamtmarkts kauft wie etwa den DAX, dann erzielt man stets die gleiche Performance wie der Marktdurchschnitt, ...
Read More »Die einzelnen Anlagestrategien – die Dividendenstrategie
Bei den Anlagestrategien, die den Markt übertrumpfen und zu edier Überrendite führen sollen, unterscheidet man solche, die auf der Fundamentalanalyse und damit den Bilanzkennzahlen beruhen, und solche, die sich auf die technische Analyse der Aktienkurse berufen. Alle diese Anlagestrategien wurden wissenschaftlich überprüft und an mehreren unterschiedlichen Zeiträumen getestet. Obwohl etliche Anlagestrategien alle Tests bestanden, mussten einige im Nachhinein aufgegeben werden. Es stellte sich heraus, dass die zu erzielenden Überrenditen so ...
Read More »Anlagestrategien mit anderen Kriterien beim Aktienkauf
Neben der weit verbreiteten Dividendenstrategie gibt es natürlich noch eine Fülle anderer Kennzahlen, die sich für eine Anlagestrategie eignen. Auch in diesem Bereich war Motley Fool aktiv. Für Aufsehen sorgte beispielsweise die Keystone-Strategie. Die Keystone-Strategie Als Grundlage diente eine Datenbank in den USA mit 1700 Aktien, die vom Finanzdienstleister Value Line betrieben wird. In dieser Datenbank werden alle Aktien in 5 Kategorien untergliedert, wobei die Kategorie 1 alle Aktien mit ...
Read More »Fundamentalanalyse beim Aktienhandel – die Dividendenrendite
Die Dividendenrendite wird berechnet, indem man den Börsenkurs durch die Dividende je Aktie teilt. Da manche Aktiengesellschaften gar keine Dividenden ausschütten, ist bei ihnen die Dividendenrendite gleich Null. Dies gilt insbesondere für Technologieunternehmen, die vorzugsweise die Gewinne wieder in technische Innovationen reinvestieren. Untersuchungen haben gezeigt, dass Aktien mit einer hohen Dividendenrendite langfristig eine bessere Performance erzielen als Unternehmen, die nur eine geringe oder gar keine Dividende ausschütten. Einige wichtige Anlagestrategien ...
Read More »Die einzelnen Anlagestrategien – andere diversen Dividendenstrategien
Die Entdeckung der Dividendenstrategie führte zu einer fieberhaften Suche nach weiteren Verbesserungen, um die Überrendite noch zu steigern. Die Experten durchforsteten die Datenberge und fanden weitere Anhaltspunkte. Insgesamt gibt es eine ganze Reihe von Dividendenstrategien, die durch weitere Kriterien optimiert wurden. Wie sich am Ende am zeigen wird, ist die Rendite bei manchen Strategien so gering, dass sie die Transaktionskosten nicht völlig abdeckt. Small Dogs of the Dow Diese verbesserte ...
Read More »Portfoliomanagement – Investmentfonds und Zertifikate
Investmentfonds haben den entscheidenden Vorteil, dass sie das Risiko wesentlich senken, denn ein durchschnittlicher Investmentfonds verwaltet zwischen 50 und 100 Aktien, die nach sorgfältigen, wissenschaftlichen Kriterien ausgesucht wurden. Das Management kann jederzeit Papiere veräußern oder hinzukaufen und die aktuelle Marktlage berücksichtigen. Besonders gute Investmentfonds haben ihre Experten meist vor Ort und können so auch in Schwellenländern das Marktgeschehen ständig beobachten. In vielen Fachpublikationen werden daher Investmentfonds als die ideale Geldanlage ...
Read More »Portfoliomanagement beim Aktienhandel
Grundlage jeder vernünftigen Altersvorsorge ist ein sinnvolles Portfoliomanagement. Das Portfolio oder das Portefeuille ist die Gesamtheit aller Anlageformen und Wertpapiere, die sich in Ihrem Depot befindet. Die wichtigste Frage, die sich für Anleger generell stellt, ist: Wie hoch sollte der Aktienanteil sein, und welche anderen Anlageformen benötigt man noch für ein ausgewogenes Portfolio? Eine alte Faustregel lautet: Der Aktienanteil beträgt 100 minus Lebensalter. Wenn Sie also jetzt 30 Jahre alt ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen