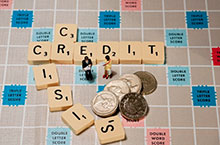Angenommen, Sie haben sich für die Zusammenarbeit mit einer Direktbank entschieden. Nun stellt sich die weitergehende Frage: Möchten Sie nur ganz bestimmte Dienstleistungen des Geldinstituts in Anspruch nehmen oder haben Sie sich vorgenommen, Ihrer bisherigen Hausbank voll und ganz den Rücken zu kehren? Gehen wir zunächst davon aus, dass Sie sich nur für ganz bestimmte Dienstleistungen der filiallosen Bank entscheiden, zum Beispiel für ein Festgeldkonto, ein Wertpapierdepot oder eine Baufinanzierung. ...
Read More »Tag Archives: mit aktien geld verdienen
Phase der Konsolidierung bei den Direktbanken und Angebote
Auch bei den breiter aufgestellten Direktbanken setzte in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre eine allmähliche Konsolidierungs- und Konzentrationsphase ein. Auffallend dabei ist, dass zunehmend ausländische Finanzdienstleister den deutschen Markt für das filiallose Bankgeschäft entdeckten. Die 1957 gegründete CC-Bank (CC = Car Kredit), die sich in den ersten Jahren auf die Finanzierung von Autos und anderen privaten Konsumgütern konzentriert hatte, wurde 1996 zur hundertprozentigen Tochter der spanischen Großbank Santander Central Hispano. ...
Read More »Direktbanking, Direktbrokerage oder Onlinebanking wählen und Angebote
Vielleicht haben Sie sich diese Frage auch schon gestellt: Was genau ist eigentlich Direktbanking? Wie unterscheidet es sich von Direktbrokerage und vor allem von Onlinebanking, das mittlerweile so gut wie jede Bank und Sparkasse in Deutschland anbietet? Sorgen wir an dieser Stelle für Klarheit und nehmen hierzu einige Begriffe unter die Lupe, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen, hinter denen aber zum Teil ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle stehen. Die noch ...
Read More »Wie eine Notlösung den Markt revolutionierte
Die Gewerkschaften hatten allen Grund, zufrieden zu sein: Nach zähen Verhandlungen hatten sich die Arbeitgeber der Baubranche bereit erklärt, ihren Mitarbeitern zusätzlich zum Lohn die Sparbeiträge für die staatlich geförderten vermögenswirksamen Leistungen (damals besser bekannt als 312-DM-Gesetz) zu zahlen. Die Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden feierte diesen Erfolg als Durchbruch. Doch in der Praxis ergaben sich unversehens Probleme von ganz anderer Seite: Viele Banken weigerten sich, für die Bauarbeiter unter ihren Kunden entsprechende ...
Read More »Direktbanken sind älter als das Internet
Viele Leser werden sich noch gut erinnern: Das Jahr 1969 war für die US-Technologie ein voller Erfolg. Im Sommer landeten mit dem Raumschiff Apollo 11 zum ersten Mal Menschen auf dem Mond und wenige Wochen später kam es an amerikanischen Universitäten zu einem auf den ersten Blick sonderbaren Experiment: Vier Großrechner wurden miteinander verbunden und konnten fortan Daten austauschen. Das war der Startschuss für das Internet, auch wenn die kommerzielle ...
Read More »Großes Potenzial für Direktbanking in die Zukunft und Angebote
Bemerkenswert erscheint es schon, dass die etablierten Banken den Trend in Richtung Direktbanking lange Zeit nicht erkannten oder negierten. Schon zum Jahreswechsel 2003/2004 erschien immerhin eine Studie des Marktforschungsinstituts infas TTR, die mit spektakulären Zahlen und Prognosen überraschte. Im Jahr 1997 hatte der Bankenfachverband ein Direktbanken-Potenzial von 5,4 Millionen Kunden vorhergesagt. Sechs Jahre später war diese Zahl bereits er- i eicht. Kein Wunder, dass die Marktforscher ihre Prognosen für die ...
Read More »Das Geschäftsmodell der Direktbroker verstehen
Bis in die 1990er-Jahre hinein galt das filiallose Bankgeschäft trotz seiner vereinzelten Erfolge als Nischenangebot, das von den Kunden vornehmlich für einfache Sparformen oder zur Aufnahme von Ratenkrediten genutzt wurde. In Bewegung kam die Branche durch den Markteintritt der bereits erwähnten Direkt- oder Discountbroker. Das Prinzip klingt überzeugend: Der Anleger ordert seine Aktien, Rentenpapiere oder Fondsanteile online oder per Telefon und spart die zum Teil recht hohen Transaktionskosten, die von ...
Read More »Wo finden Sie die passende Direktbank – Angebote
Vielleicht erinnern Sie sich noch: Als Vorjahren die ersten Billigflieger auch um deutsche Passagiere buhlten, war die Skepsis zunächst groß: Wie kann es sein, dass die Fahrt zum Flughafen erheblich teurer ist als das Ticket nach London, Rom oder Stockholm? Mancher zweifelte an dem nachhaltigen Erfolg dieses Geschäftsmodells und sagte den Low-fare-Carriers, wie sich die Billigairlines selbst nennen, ein baldiges Ende voraus. Doch dann entwickelten sie sich sehr schnell zu ...
Read More »Die Internet- und Technologie-Blase
Wenn Sie sich nicht von allem isoliert haben, was wir Zivilisation nennen, dann haben Sie sicher schon von dem explosiven Wachstum im Internet gehört. Mitte der neunziger Jahre ging eine Reihe von Internet-Unternehmen an die Börse. Viele frühe Börsengänge von Internet-Unternehmen konnten nicht richtig Fuß fassen. Doch Ende der 90er Jahre erlebten einige dieser Aktien einen fantastischen Wertzuwachs. Zu den großen Namen im Internet gehören Unternehmen wie der Service-Provider America ...
Read More »Mit Verleihen von Geld Werden nur die Banken reich
In diesem Finanzportal habe ich die hauptsächlichen Typen der Kapitalanlagen und ihre möglichen Risiken und Gewinne besprochen. Hier haben Sie auch Investments kennen gelernt, bei denen Sie Ihr Geld an eine Organisation verleihen, beispielsweise an ein Unternehmen oder an die Regierung, und dafür einen festen Zinssatz bekommen. Wenn Sie allerdings wirklich möchten, dass Ihr Geld wächst, dann sind diese Kapitalanlagen nichts für Sie. Allerdings, auch die aggressivsten Anleger haben ein ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen