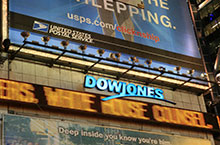Privatanleger sollten vor allem den Emissionsprospekt sorgfältig lesen, der für jedes Unternehmen erstellt wird, das einen Börsengang anstrebt. Das Besondere an diesem Prospekt ist die so genannte Prospekthaftung; für die Richtigkeit aller Angaben und Zahlen haftet nämlich nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch die beteiligten Emissionsbanken. Wenn der Anleger aufgrund unrichtiger, falscher oder unvollständiger Angaben Geld verliert, kann er Schadenersatz geltend machen. Die Börsen haben für den Inhalt der ...
Read More »Aktien
Unternehmensbesichtigungen und Unternehmen im Alltag beim Aktienkauf
Besonders aufschlussreich kann es sein, wenn Sie dem Unternehmen selbst einen Besuch abstatten. In manchen Unternehmen gibt es nämlich Betriebsbesichtigungen, die Sie nutzen sollten. Zwar können Sie dann die Ertragssituation im Ausland oder die Entwicklung der Umsatzerlöse immer noch nicht einschätzen, aber häufig kann man die Stimmung in einem Unternehmen schon äußerlich erkennen. Es soll zwar Unternehmen geben, die mit viel Aufwand und prachtvollen Festen es geschafft haben, die Öffentlichkeit ...
Read More »Die Kapitalerhöhung beim Aktienkauf
Viele Unternehmen möchten nach einiger Zeit expandieren und zusätzliche Investitionen tätigen. Besonders neu gegründete Aktiengesellschaften haben nach ein paar Jahren zusätzlichen Kapitalbedarf. Um diesen nicht durch die Aufnahme von Fremdkapital decken zu müssen, ist es möglich, das Eigenkapital zu vergrößern. Hierzu gibt die Aktiengesellschaft neue Aktien aus. Dieses Verfahren nennt man Kapitalerhöhung. Die neuen Aktien werden dabei mit Hilfe von Banken an der Börse oder bei anderen Investoren platziert. Die ...
Read More »Die Dividendenjäger beim Aktienkauf
Die meisten Hauptversammlungen finden bis auf wenige Ausnahmen zwischen April und Juli statt. Während dieser Monate folgt ein Termin dem anderen, und in den Nachrichten werden täglich oft mehrere Geschäftsberichte vorgestellt. Das ist die Hauptsaison für die so genannten Dividendenjäger. Die Dividende ist die Ausschüttung des Gewinns. Etliche Aktiengesellschaften schütten überhaupt keine Dividende aus – das gilt insbesondere für neu gegründete Unternehmen oder Technologiewerte, die die Gewinne meist wieder reinvestieren. ...
Read More »Neuemissionen und wie Aktien an die Börse kommen
Entgegen landläufiger Meinung sind nicht alle Aktien börsennotiert, sondern etliche Aktien werden privat platziert, d.h. die Aktiengesellschaft verkauft die Aktien direkt an private oder institutionelle Anleger. Wenn Ihnen ein solches Angebot in den Briefkasten flattert, sollten Sie Vorsicht walten lassen; denn solche Angebote können dubios sein, da diese Aktien nicht der Börsenaufsicht unterliegen. Darüber hinaus ist es sehr schwierig, solche Aktien wieder zu verkaufen. Ähnlich wie bei GmbH-Anteilen müssen Sie ...
Read More »Wie kaufe ich Aktien – die Wertpapierkernnummer WKN
Um eine Aktie oder ein anderes Wertpapier zu kaufen, benötigen Sie die Wertpapierkennnummer. Jedes in Deutschland notierte Wertpapier, seien es Aktien, Optionsscheine, Zertifikate, Investmentfonds oder Anleihen, hat eine sechsstellige Wertpapierkennnummer (WKN). Obwohl bei Aktien Verwechslungen geringer sind und jeder Bankberater die Aktien von Siemens, Deutscher Bank oder SAP kennt, kann es dennoch sinnvoll sein, die Wertpapierkennnummer herauszusuchen. Denn manche Aktien gibt es als Stamm- und Vorzugsaktien. Bei ausländischen Aktien sind ...
Read More »Die einzelnen Anlagestrategien – die Dividendenstrategie
Bei den Anlagestrategien, die den Markt übertrumpfen und zu edier Überrendite führen sollen, unterscheidet man solche, die auf der Fundamentalanalyse und damit den Bilanzkennzahlen beruhen, und solche, die sich auf die technische Analyse der Aktienkurse berufen. Alle diese Anlagestrategien wurden wissenschaftlich überprüft und an mehreren unterschiedlichen Zeiträumen getestet. Obwohl etliche Anlagestrategien alle Tests bestanden, mussten einige im Nachhinein aufgegeben werden. Es stellte sich heraus, dass die zu erzielenden Überrenditen so ...
Read More »Anlagestrategien mit anderen Kriterien beim Aktienkauf
Neben der weit verbreiteten Dividendenstrategie gibt es natürlich noch eine Fülle anderer Kennzahlen, die sich für eine Anlagestrategie eignen. Auch in diesem Bereich war Motley Fool aktiv. Für Aufsehen sorgte beispielsweise die Keystone-Strategie. Die Keystone-Strategie Als Grundlage diente eine Datenbank in den USA mit 1700 Aktien, die vom Finanzdienstleister Value Line betrieben wird. In dieser Datenbank werden alle Aktien in 5 Kategorien untergliedert, wobei die Kategorie 1 alle Aktien mit ...
Read More »Fundamentalanalyse beim Aktienhandel – die Dividendenrendite
Die Dividendenrendite wird berechnet, indem man den Börsenkurs durch die Dividende je Aktie teilt. Da manche Aktiengesellschaften gar keine Dividenden ausschütten, ist bei ihnen die Dividendenrendite gleich Null. Dies gilt insbesondere für Technologieunternehmen, die vorzugsweise die Gewinne wieder in technische Innovationen reinvestieren. Untersuchungen haben gezeigt, dass Aktien mit einer hohen Dividendenrendite langfristig eine bessere Performance erzielen als Unternehmen, die nur eine geringe oder gar keine Dividende ausschütten. Einige wichtige Anlagestrategien ...
Read More »Die einzelnen Anlagestrategien – andere diversen Dividendenstrategien
Die Entdeckung der Dividendenstrategie führte zu einer fieberhaften Suche nach weiteren Verbesserungen, um die Überrendite noch zu steigern. Die Experten durchforsteten die Datenberge und fanden weitere Anhaltspunkte. Insgesamt gibt es eine ganze Reihe von Dividendenstrategien, die durch weitere Kriterien optimiert wurden. Wie sich am Ende am zeigen wird, ist die Rendite bei manchen Strategien so gering, dass sie die Transaktionskosten nicht völlig abdeckt. Small Dogs of the Dow Diese verbesserte ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen