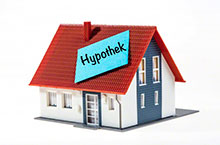Die Investitionsmöglichkeiten sind in den letzten Jahren dank neuer Finanzprodukte für den Anleger immer vielfältiger geworden. Trotzdem gehören die Deutschen insgesamt immer noch zu den eher konservativen Anlegern, die sich gern an sogenannte sichere Produkte halten, also Sparbriefe, Renten etc. Der Börsencrash und der Zusammenbruch des Neuen Marktes Anfang des neuen Jahrtausends haben dazu entscheidend beigetragen. Der Hype um den Neuen Markt hatte viele Börsenneulinge zu Spekulationen und zur Investition ...
Read More »Banken
Vom Nischenanbieter zur Hausbank
Dass die Direktbanken gerade auf dem deutschen Markt reüssieren konnten, lässt sich jedoch nicht allein mit den unbestritten günstigeren Kostenstrukturen dieser filiallosen Geldinstitute erklären. Zumal Direktbanken einerseits zwar Miete und Mitarbeitergehälter für die Geschäftsstellen vor Ort sparen, auf der anderen Seite aber erhebliche Summen ins Marketing investieren müssen, um Neukunden zu gewinnen oder Bestandskunden für das sogenannte Cross Selling-Geschäft zu aktivieren, sprich: ihnen weitere Bankprodukte zu verkaufen. Ein zusätzlicher, nicht ...
Read More »Kreditkarten von Direktbanken, Vorteile und Angebote
Selbstverständlich können Sie bei Ihrer Direktbank eine oder mehrere Kreditkarten beantragen. Bei einigen Instituten bekommen Sie eine solche Karte sozusagen als Draufgabe auf das Girokonto, so zum Beispiel bei der DKB Bank und der ING-DiBa. Sie haben grundsätzlich die Wahl, ob Sie eine Kreditkarte in Kombination mit dem Girokonto wählen oder sich für eine Solo-Lösung unterschieden, das heißt eine Kreditkarte ohne gleichzeitige Eröffnung eines Girokontos wünschen. Ein Beispiel: Sie unterhalten ...
Read More »Zulagen und Steuervorteile bei der Riester-Rente
Dort, wo der Staat selbst Produkte initiiert hat, zeigt er sich zumindest etwas großzügiger. Die sogenannte Riester-Rente ist zwar bei den Deutschen nicht sonderlich beliebt, dennoch kann sie sich rechnen. Die Förderung von Riester-Produkten umfasst zwei Komponenten: Zum einen erhält der Versicherungs- oder Bankkunde eine staatliche Zulage und zum zweiten kann er seine Sparleistung als Sonderausgabenabzug von der Steuer absetzen. Allerdings muss er dafür im Ruhestand seine private Rente versteuern. ...
Read More »Welche Direktbank ist die richtige für Sie – Angebote
Wer die Wahl hat, hat bekanntlich die Qual. Neben dem Marktführer ING-DiBa gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Direktbanken. Teilweise handelt es sich dabei um ehemalige Direktbkroker, wie etwa Comdirect oder die DAB Bank, die ihr Produktportfolio ausgeweitet haben und nun das gesamte Dienstleistungsspektrum einer Hausbank abdecken – einschließlich Girokonten. Auch manche Autobank, früher eher auf die Finanzierung des fahrbaren Untersatzes spezialisiert, bietet heute den kompletten Service einer Hausbank ...
Read More »Die Kommunikation mit Direktbanken nachvollziehen
Direktbanken haben in der Regel keine oder nur wenige Filialen. Das ist ihr großer Vorteil. Sie sparen dadurch jede Menge Geld ein und können deshalb in vielen Fällen bessere Konditionen bieten als die herkömmlichen Filialbanken. Für den Kunden bedeutet dies jedoch, dass er seine Bankgeschäfte überwiegend per PC oder per Telefon abwickeln muss. Es ist zwar ebenfalls möglich, mit der Direktbank schriftlich per Fax oder auf dem Postweg zu kommunizieren, ...
Read More »Die besten Direktbanken in Deutschland und ihre Angebote
Die Fakten auf einen Blick Das Geschäftsmodell der Direktbanken beruht auf dem Prinzip, Standardprodukte von guter Qualität zu einem möglichst geringen Preis zu verkaufen. Eine persönliche Beratung in Filialen oder der Vertrieb von sehr erklärungsbedürftigen Produkten passt nicht in diese Abläufe. Angesichts geringer Margen müssen Direktbanken schnell wachsen und sich eine ausreichende Zahl von Kunden sichern. Vor der Wahl der für Sie passenden Direktbank sollten Sie Ihre individuellen Prioritäten festlegen. ...
Read More »Unterschiedliche Arten und Angebote von Baufinanzieren
Den Markt der Baufinanzierer teilen sich im Wesentlichen drei Gruppen, die unterschiedliche Produkte anbieten: Banken und Sparkassen (einschließlich Direktbanken und Hypothekenbanken), Lebensversicherungen und Bausparkassen. In vielen Fällen arbeiten Darlehenskunden auch mit zwei Anbietern von Baugeld zusammen, beispielsweise mit einer Bausparkasse und einer Bank. Das ist freilich nur möglich, wenn sich eines der finanzierenden Institute mit einer zweitrangigen Absicherung im Grundbuch zufrieden gibt. Bei Bausparkassen ist dies die Regel. Jede dieser ...
Read More »Direktbanking die Fakten auf einen Blick und weitere Angebote
Erkundigen Sie sich zu Beginn einer Geschäftsbeziehung mit einer Direktbank über die Höhe der Einlagensicherung. In den Staaten der Europäischen Union müssen Banken Geldeinlagen nur bis zu einer Höhe von 20.000 Euro pro Kunde absichern. Gehört die betreffende Direktbank dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken an, ist das Guthaben weitaus höher abgesichert (faktisch bis zu 100 Prozent). Callcenter bilden das Herzstück einer Direktbank. In der Regel handelt es sich um ...
Read More »Wertpapierdepots bei Direktbanken einlegen und Angebote
Beim Wertpapierdepot kann der Anleger jede Menge Kosten sparen. Viele Direktbanken oder Direktbroker bieten Wertpapierdepots ohne Grundgebühr an. Bei einem Depotvolumen von 10.000 Euro, zehn Depotposten, Onlinehandel, fünf Orders jährlich bei einem durchschnittlichen Ordervolumen von 2000 Euro ergaben sich in einer Berechnung auf der Internetseite finanztip*de Anfang 2008 folgende Kosten: Während die Depotkosten bei den Direktbanken bei null lagen, brachte es zum Beispiel das db Pri- vatDepot Comfort der Deutschen ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen