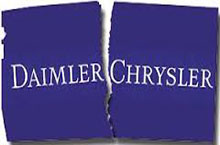Natürlich gibt es Gruppen, die von den fiesen Geschäften der Banken profitieren: die Aktionäre der Geldhäuser, die, vom Ballast kritischer Kredite befreit, auf kräftige Kursgewinne hoffen können. Denn die Börse belohnt rabiates Verhalten und Turbokapitalismus. Und an die Adresse der Aktionäre gerichtet erklärt denn auch die Hypo Real Estate ihre Philosophie: Offenheit, Fairness und Transparenz kennzeichnen die Unternehmenskultur der Hypo Real Estate Group. Die Gruppe nimmt durch zahlreiche Projekte ihre ...
Read More »Tag Archives: geldanlage vergleich
Lukratives Wettbewerbshindernis beim Immobilienkredit
Die Vorfälligkeitsentschädigungen wirken auch als Wettbewerbshindernis. Wer einmal ein Haus oder eine Wohnung auf Pump finanziert hat, kann sich gut vorstellen, welcher Stress auf den Besitzer zukommt, der seine Immobilie verkaufen will, weil er aus Berufsgründen in eine andere Stadt ziehen muss, seinen Job verliert oder andere Gründe zur vorzeitigen Ablösung des Kredites führen. Längst nicht alle Banken sind kulant und übertragen beim Kauf einer anderen Immobilie die alte Hypothek ...
Read More »Der Fall von DaimlerChrysler richtig verstehen
Der Weg des Daimler-Konzerns ins Chaos begann Mitte der 1980er Jahre. Damals leitete Edzard Reuter den Autohersteller und Alfred Herrhausen den Geldkonzern. Beide waren in ihren Organisationen Ausnahmeerscheinungen: eher Intellektuelle als Pragmatiker, eher Strategen als Taktiker, und beide äußerst eloquent, wenn es ihren Interessen diente. Auch nach der politischen Farbenlehre bildeten sie ein interessantes Gespann. Reuter, der Sohn eines ehemaligen Berliner Bürgermeisters, stand der SPD nahe, und Herrhausen, der Quereinsteiger ...
Read More »Verluste auf allen Ebenen für die Banken und Sparkassen in den 90er
Den größten Aderlass an Arbeitsplätzen in der jüngsten Vergangenheit verursachten die Banken jedoch selbst durch ihren Hang zu Größenwahn, Allmacht und Omnipräsenz in allen Märkten und Sparten des Geldgeschäfts. Zigtausende von Jobs sind seit Mitte der 1990er Jahre, bereits abgebaut worden, weil Banken zusammengelegt und dadurch entstandene Doppelbesetzungen abgeschafft wurden. Nicht zum Wohl der Kunden und Mitarbeiter oder gar der Aktionäre – wie das Beispiel der HypoVereinsbank zeigt. So einfach ...
Read More »Wirbel um das BGH-Urteil
Die Badenia legte gegen das Karlsruher OLG-Urteil Revision ein. Der Fall landete beim Bundesgerichtshof. Für die Klägerin waren das keine guten Aussichten, denn die BGH-Urteile hatten sich in den Jahren zuvor nicht immer als verbraucherfreundlich erwiesen. Wir hoffen, dass die im Urteil [des OLG Karlsruhe] genannten Gründe auch vor dem BGH ausreichen, sagte damals der Anwalt der Klägerin. Grund für zaghaften Optimismus lieferte 2006 der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit einer ...
Read More »Vorzeitige Rückzahlung ist unerwünscht beim Immobilienkredit
Wer seinen Immobilienkredit vorzeitig ablöst, müsste den Banken doch eigentlich einen Gefallen erweisen. Doch weit gefehlt. Die Geldhäuser wollen das geliehene Kapital gar nicht vor Ablauf der Darlehenszeit zurück. Denn dann müssten sie ja über neue Anlagen für das Geld nachdenken. Das macht Arbeit, und die muss der Kunde bezahlen. Also wurde die Vorfälligkeitsentschädigung erfunden. Diese Gebühr sollte sich an den Zinsen orientieren, die die Bank erhält, wenn sie das ...
Read More »Aktienkurse im Keller in den USA und in Japan
Für die Aktionäre waren Schrempps Abenteuer in den USA und in Japan eine herbe Enttäuschung. Der Kurs der Aktie war von einem Höchststand von über 100 Euro im Frühjahr 1998 auf rund 46 Euro im Frühjahr 2002 abgerutscht. Im Herbst 2001, nach den Terroranschlägen von New York und Washington, war der Wertverlust noch dramatischer ausgefallen: Das Daimler- Chrysler-Papier war auf 29 Euro durchgesackt. Und die Talfahrt ging schier unaufhaltsam weiter. ...
Read More »Vertrauen ist wichtig bei – Deutsche Telekom Aktien
Ich war so gerne Aktionär, sang 1996 Manfred Krug in der millionenschweren Werbekampagne, die die Deutsche Telekom für ihr Börsendebüt geschaltet hatte. Die Deutschen, ein Volk von Sparbuchinhabern, sollten sich an der Privatisierung des Staatskonzerns beteiligen und zu einem Volk von Aktionären werden – mit Hilfe der Volksaktie Telekom. Begleitet wurde der spektakuläre globale Börsengang – die Aktien des größten deutschen Telekommunikationsunternehmens wurden gleichzeitig an allen großen Börsen der Welt ...
Read More »Kreditpolitik der Banken und Sparkassen
Mit ihrer Kreditpolitik bestimmen Deutschlands Banken, welches Unternehmen im Ernstfall Kapital zum Überleben, zum Wachsen, für Investitionen und neue Produkte bekommt. Sie sind sozusagen die Schiedsrichter, die den Wettbewerb nach ihren Spielregeln lenken, fordern oder abwürgen. Sie entscheiden mit, wer Arbeitsplätze ausbauen darf und wer Pleite machen muss. Die Banken sind sozusagen die oberste Instanz und ein Machtfaktor im Staatsgefüge. Allein die Tatsache, dass sie sich in den meisten Fällen ...
Read More »Den eigenen Vorteil fest im Blick für die Deutschen Bank
Im Februar 2007 gaben die Analysten der Deutschen Bank eine Analyse der DaimlerChrysler-Aktie heraus, die zu größten Hoffnungen berechtigte. Sie prognostizierten ein Kursziel zwischen 54 bis 74 Euro. Bei den Anlegern kam diese Erwartung allerdings nicht so gut an: Denn die Prognose übertraf die Analysen der Konkurrenz bei weitem. Die Experten von Merrill Lynch und Citibank sahen den Aktienkurs eher zwischen 55 und 60 Euro. Dass sich die Deutsche Bank ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen