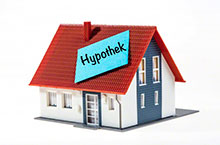Am ersten Januar 2007 trat eine Richtlinie in Kraft, die das europäische Bankensystem sicherer machen und die Unternehmen stärken sollte. Basel II heißt das Wunderwerk. Der für Binnenmarkt und Dienstleistungen zuständige EU-Kommissar Charlie McCreevy erklärte: Die Umsetzung dieser Richtlinie wird sowohl der EU-Wirtschaft als auch der Finanzstabilität zugute kommen und Vorteile für die Unternehmen und die Verbraucher bringen. Auch der frühere Vorsitzende des Basler Ausschusses, William McDonough, bekundete seine Zuneigung ...
Read More »Tag Archives: geldanlage vergleich
Lukratives Spiel mit der Angst bei den Immobiliengeschäften
Dubiose Immobiliengeschäfte zur Kapitalvernichtung haben hierzulande trotz aller Pleiten und Bankenkrisen immer noch oder schon wieder Konjunktur. Eigentumswohnungen werden den Kunden als Anlageobjekte zur Altersvorsorge angepriesen. Unter dem Etikett Erwerbermodell werden jedoch nicht gerade die Filetstücke des Immobilienmarkts an den Mann oder die Frau gebracht. Die cleveren Verkäufer nehmen die potenziellen Opfer, meist Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen, in die Zange, schüren deren Angst vor Altersarmut, locken mit niedrigen monatlichen ...
Read More »Böse Überraschung für die Banken in Deutschland in den 90er Jahren
Wenige Wochen nach dem glanzvollen Start entdeckte der Chef der neuen Bank, Albrecht Schmidt, dass Eberhard Martini, sein neuer Partner, Kreditrisiken bei Immobiliengeschäften in Höhe von 3,5 Milliarden € nicht angegeben hatte. Diese Wertberichtigungen hätten im Jahresabschluss 1997 berücksichtigt werden müssen. Schmidt war persönlich tief erschüttert und machte aus seiner Verärgerung keinen Hehl: Ich habe eine bittere Enttäuschung erlitten und eine gehörige Wut im Bauch, erklärte der Bankchef. Er war ...
Read More »Forderung der Politik für Schrottimmobilien
Mit dem Persilschein hatte das Oberste Gericht der Bundesrepublik Deutschland den Banken die Sorge genommen, dass sie im Falle eines Widerrufs die faulen Kreditverträge rückführen und die Schrottimmobilien wieder zurücknehmen müssen. Wieder erreichte die deutsche Kreditwirtschaft eine Sonderstellung – zu Lasten unbedarfter Anleger. Deshalb fordert Prof. Udo Reifner, Leiter des Hamburger Instituts für Finanzdienstleistungen, einen gesetzlichen Schutz der Verbraucher vor der Abzockerbranche. Dass ein Eingreifen der Politik unumgänglich ist, zeigt ...
Read More »Im Würgegriff der Heuschrecken und der Fall Friedrich Grohe AG
Renditegierige Private-Equity-Gesellschaften bewahren die ausgezehrten Unternehmen zwar vor dem Kollaps, doch in den seltensten Fällen vor Zerschlagung und Verkauf. Nach dem Rückzug der Heuschrecken ist das Unternehmen in der Regel nicht mehr wiederzuerkennen. Es wird rationalisiert, filetiert und amputiert, was das Zeug hält, um beim Wiederverkauf nach einigen Monaten oder Jahren eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Wie Private-Equity-Fonds zusammen mit den Banken Tausende von Arbeitsplätzen vernichten können, zeigt der ...
Read More »Kreditkarten von Direktbanken, Vorteile und Angebote
Selbstverständlich können Sie bei Ihrer Direktbank eine oder mehrere Kreditkarten beantragen. Bei einigen Instituten bekommen Sie eine solche Karte sozusagen als Draufgabe auf das Girokonto, so zum Beispiel bei der DKB Bank und der ING-DiBa. Sie haben grundsätzlich die Wahl, ob Sie eine Kreditkarte in Kombination mit dem Girokonto wählen oder sich für eine Solo-Lösung unterschieden, das heißt eine Kreditkarte ohne gleichzeitige Eröffnung eines Girokontos wünschen. Ein Beispiel: Sie unterhalten ...
Read More »Die Kommunikation mit Direktbanken nachvollziehen
Direktbanken haben in der Regel keine oder nur wenige Filialen. Das ist ihr großer Vorteil. Sie sparen dadurch jede Menge Geld ein und können deshalb in vielen Fällen bessere Konditionen bieten als die herkömmlichen Filialbanken. Für den Kunden bedeutet dies jedoch, dass er seine Bankgeschäfte überwiegend per PC oder per Telefon abwickeln muss. Es ist zwar ebenfalls möglich, mit der Direktbank schriftlich per Fax oder auf dem Postweg zu kommunizieren, ...
Read More »Die besten Direktbanken in Deutschland und ihre Angebote
Die Fakten auf einen Blick Das Geschäftsmodell der Direktbanken beruht auf dem Prinzip, Standardprodukte von guter Qualität zu einem möglichst geringen Preis zu verkaufen. Eine persönliche Beratung in Filialen oder der Vertrieb von sehr erklärungsbedürftigen Produkten passt nicht in diese Abläufe. Angesichts geringer Margen müssen Direktbanken schnell wachsen und sich eine ausreichende Zahl von Kunden sichern. Vor der Wahl der für Sie passenden Direktbank sollten Sie Ihre individuellen Prioritäten festlegen. ...
Read More »Direktbanking die Fakten auf einen Blick und weitere Angebote
Erkundigen Sie sich zu Beginn einer Geschäftsbeziehung mit einer Direktbank über die Höhe der Einlagensicherung. In den Staaten der Europäischen Union müssen Banken Geldeinlagen nur bis zu einer Höhe von 20.000 Euro pro Kunde absichern. Gehört die betreffende Direktbank dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken an, ist das Guthaben weitaus höher abgesichert (faktisch bis zu 100 Prozent). Callcenter bilden das Herzstück einer Direktbank. In der Regel handelt es sich um ...
Read More »Karten verloren – was tun wir bei Onlinebanking
Wer seine Bank- oder Kreditkarten verliert und Kunde einer Direktbank ist, hat im Prinzip nichts anderes zu tun als jeder Kunde bei einer Filialbank: den Verlust sofort melden und die Karte sperren lassen. Je nachdem, um welche Karten es sich handelt, können Sie das bei Ihrer Bank oder bei der Kreditkartenorganisation veranlassen. Auch für EC-Karten gibt es eine zentrale Rufnummer. Praxistipp: Direktbanken haben auf ihrer Internetseite in der Regel einen ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen