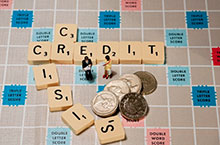Auch bei den breiter aufgestellten Direktbanken setzte in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre eine allmähliche Konsolidierungs- und Konzentrationsphase ein. Auffallend dabei ist, dass zunehmend ausländische Finanzdienstleister den deutschen Markt für das filiallose Bankgeschäft entdeckten. Die 1957 gegründete CC-Bank (CC = Car Kredit), die sich in den ersten Jahren auf die Finanzierung von Autos und anderen privaten Konsumgütern konzentriert hatte, wurde 1996 zur hundertprozentigen Tochter der spanischen Großbank Santander Central Hispano. ...
Read More »Direktbanking
Schnell und einfach – die Depoteröffnung für Direktbanking
Für die Eröffnung eines Wertpapierdepots bei einer Direktbank oder einem Direktbroker gelten dieselben Vorschriften wie für die Einrichtung eines Giro- oder Sparkontos. Das heißt: Der Kunde muss seine Personalien durch das beschriebene Postident-Verfahren überprüfen und bestätigen lassen. Unterhält er bereits ein Konto bei der betreffenden Direktbank, entfällt diese Prozedur. Die meisten Kunden verfügen bereits über ein Wertpapierdepot bei ihrer Hausbank oder bei einer Fondsgesellschaft. Selbstverständlich kann jeder Anleger mehrere Depots ...
Read More »Die kleinen Unterschiede in der Einlagensicherung und Angebote
Eine Direktbank hat keine Gesichter, keine Angestellten, denen man von Angesicht zu Angesicht in der Filiale gegenübersteht. Das Gefühl, bei Schwierigkeiten unter Umständen hilflos zu sein, niemanden verantwortlich machen zu können, hält manche Verbraucher davon ab, zu einer Direktbank zu wechseln, auch wenn sie im Vergleich zur Filialbank noch so günstig sein mag. Die gesichtslose Abwicklung der Direktbanken führt bei diesen Kunden zu dem diffusen Gefühl, dass das Geld bei ...
Read More »Weshalb Kunden ihren Filialbanken den Rücken kehren
So wie Sandra S. haben viele Bankkunden in Deutschland und auch in den Nachbarländern, wie etwa Österreich, gehandelt: Sie kehrten ihrer Hausbank entweder komplett den Rücken oder aber sie behielten dort lediglich noch ihr Girokonto und verlagerten ihre Sparkonten, Depots und oftmals auch ihre Immobilienfinanzierungen zu den Direktbanken, die in der Folge mit atemberaubenden Wachstumsraten aufwarteten. Allein beim deutschen Marktführer in Sachen Direktbanking – der ING-DiBa – stiegen die Kundenzahlen ...
Read More »Was erfährt der Fiskus für Direktbanken
Vorweg und ganz pauschal: Direktbanken und ihre Kunden unterliegen genau denselben steuerlichen Gesetzen und Regeln wie Kunden bei Filialbanken. Natürlich können sie auch dieselben Freistellungsbeträge in Anspruch nehmen wie jeder andere. Durch die ab Januar 2009 wirksame Abgeltungsteuer ergeben sich einige wichtige Änderungen. Die Auswirkungen auf den Anleger sind je nach Einkommen unterschiedlich. Lediglich der Sparerfreibetrag in Höhe von 801 Euro für Alleinstehende und 1602 Euro für Verheiratete bleibt bestehen. ...
Read More »Formen der privaten Altersvorsorge und Angebote
Früher war die Sache klar: Wenn die Deutschen für ihr Alter vorsorgten, schlossen sie – oftmals bedrängt von mehr oder minder seriösen Vertretern – Kapitallebensversicherungen ab. Dieses Produkt kombiniert die Hinterbliebenenversorgung im Todesfall mit der Altersversorgung (Auszahlung der sogenannten Ablaufleistung bei Renteneintritt). Seit aber die Renditen einer Kapitallebensversicherung mit dem Finanzamt geteilt werden müssen, haben diese Policen deutlich an Attraktivität eingebüßt. Doch welche Alternativen bieten sich? Sieht man von Riester-Produkten ...
Read More »Direktbanking, Direktbrokerage oder Onlinebanking wählen und Angebote
Vielleicht haben Sie sich diese Frage auch schon gestellt: Was genau ist eigentlich Direktbanking? Wie unterscheidet es sich von Direktbrokerage und vor allem von Onlinebanking, das mittlerweile so gut wie jede Bank und Sparkasse in Deutschland anbietet? Sorgen wir an dieser Stelle für Klarheit und nehmen hierzu einige Begriffe unter die Lupe, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen, hinter denen aber zum Teil ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle stehen. Die noch ...
Read More »Wie eine Notlösung den Markt revolutionierte
Die Gewerkschaften hatten allen Grund, zufrieden zu sein: Nach zähen Verhandlungen hatten sich die Arbeitgeber der Baubranche bereit erklärt, ihren Mitarbeitern zusätzlich zum Lohn die Sparbeiträge für die staatlich geförderten vermögenswirksamen Leistungen (damals besser bekannt als 312-DM-Gesetz) zu zahlen. Die Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden feierte diesen Erfolg als Durchbruch. Doch in der Praxis ergaben sich unversehens Probleme von ganz anderer Seite: Viele Banken weigerten sich, für die Bauarbeiter unter ihren Kunden entsprechende ...
Read More »Sparen mit Sparbuch oder doch nicht
„Schlachtet das Sparschwein!“ Mit diesem etwas martialischen Slogan versuchte eine Bank, auf dem Höhepunkt des Börsenbooms aus einem Land der Sparer eine Nation der Aktionäre zu machen. Und zunächst stieß das Kreditinstitut damit durchaus auf offene Ohren. Die Deutschen plünderten ihre Sparkonten und steckten das Geld vorrangig in „Wachstumsaktien“, die neu auf den Markt kamen und schnelle Gewinne versprachen. Im Jahr 2001 sanken die Spareinlagen der Deutschen nach Angaben der ...
Read More »Ist Direktbanking heutzutage wirklich sicher
Die Zahlen sprechen für sich: Direktbanking gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Das sieht man zum Beispiel daran, dass sich die Direktbanken in der Top-1OO-Liste der deutschen Banken immer weiter nach oben schieben. Kein Zweifel, das Vertrauen der Verbraucher in diese Geldinstitute ist in den vergangenen Jahren gewachsen – und damit auch das Vertrauen in das Onlinebanking. Dennoch sehen nach wie vor viele Verbraucher das größte Risiko der Direktbanken in der ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen