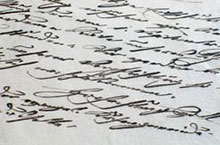Dollar als US-Dollar die Währungseinheit der USA. 1 Dollar (Abk. US-$; ISO- Währungscode USD) entspricht 100 Cents. Auch in anderen Staaten und Gebieten gibt es Dollarwährungen (z.B. Kanada: kan$; Australien: $A).Seit der Konferenz in Bretton Woods 1944 galt der US-Dollar als Leitwährung, d. h., alle Mitgliedstaaten des Internationalen Währungsfonds hatten ein grundsätzlich festes Austauschverhältnis zum Dollar (Parität). Die Belastung für den Dollar erwies sich als zu groß: 1971 gaben die ...
Read More »D E F
Entwicklungshilfe – und die Bedeutung davon – Wirtschaftsbegriffe Übersich
Entwicklungshilfe Gesamtheit aller staatlichen und privaten Maßnahmen, die von Industrieländern und internationalen Organisationen (z. B. Weltbank) zur wirtschaftlichen und sozialen Förderung von Entwicklungsländern getroffen werden. Statt von E. wird auch von Entwicklungszusammenarbeit oder wirtschaftlicher Zusammenarbeit gesprochen – entsprechend heißt das zuständige Ministerium in der Bundesrepublik Deutschland Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Bedürfnisse der Entwicklungsländer beziehen sich v. a. auf Beratungshilfe (z. B. durch Entwicklungshelfer wie Ingenieure, Ärzte) und ...
Read More »Vom Businessplan zur Gründung – und die Bedeutung davon – Wirtschaftsbegriffe Übersicht
Vor der Anmeldung eines Gewerbebetriebs oder einer freiberuflichen Tätigkeit beim Gewerbeamt bzw. Finanzamt steht die Wahl der Rechtsform des Unternehmens. Seit einigen Jahren nehmen insbesondere die freien Berufe einen großen Aufschwung, also v. a. Personengesellschaften, deren Gründung verhältnismäßig einfach ist. Andererseits besteht gerade hier die Gefahr, dass andere Fragen wie die Finanzierung, die steuerlichen Rahmenbedingungen und die Zukunftschancen der Gründungsidee zu leicht genommen werden. Mit der Wahl der Rechtsform sind ...
Read More »DAX und Deckungsbeitragsrechnung – und die Bedeutung davon – Wirtschaftsbegriffe Übersicht
DAX®, Deutscher Aktienindex der bekannteste deutsche Aktienindex und Benchmark für den deutschen Aktienmarkt ( Börse). Er umfasst die 30 umsatzstärksten deutschen Aktien, die im Prime Standard (Börse) zugelassen sind, und wird auch als DAX®-30 bezeichnet. Der DAX® repräsentiert mehr als 60% des Grundkapitals inländischer börsennotierter Gesellschaften. Gemessen am Börsenumsatz macht der Handel in diesen Aktien 75 % des deutschen Aktienhandels aus. Gewichtung und Auswahl der einbezogenen Aktienwerte werden regelmäßig aktualisiert. ...
Read More »Ertrag und Etragsgesetz – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe
Ertrag die erfolgswirksamen Einnahmen eines Unternehmens in einer Periode (z.B. aus Verkauf der erstellten Güter und Leistungen). Der E. stellt die positive Seite des im Rahmen der Finanzbuchhaltung (Gewinn-und- Verlust-Rechnung) ermittelten Erfolgs dar; übersteigt (unterschreitet) der Ertrag den Aufwand, erzielt das Unternehmen einen Gewinn (Verlust). Die Erträge bestehen zum einen aus dem betrieblich bedingten E. (Betriebsertrag), d.h. aus der Summe der Nettobeträge, die den Kunden in Rechnung gestellt werden für ...
Read More »Ehevertrag, Eidesstattliche Versicherung und Eigene Aktie – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe
Ehevertrag ein Vertrag zwischen Eheleuten, der das jeweilige Anfangsvermögen der Partner festhält sowie einen gegenseitigen Versorgungsausgleich und Unterhaltsansprüche regelt. Der Vertrag muss von einem Notar beurkundet werden; die Kosten des Vertrags richten sich nach dem gemeinsamen Vermögen und sind durch eine bundesweite Gebührenordnung festgelegt. Bei einem Vermögen von 30 000 € betragen die Beurkundungskosten etwa 250 €, zu denen noch die Mehrwertsteuer und die Auslagen des Notars addiert werden. Eidesstattliche ...
Read More »Dutyfree, EAN-System und EBITDA – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe
Dutyfree abgabenfreier Verkauf von Waren außerhalb eines Zollgebiets. Zollfrei kann z.B. hinter der Zollkontrolle in Flughäfen, auf internationalen Flügen im Luftraum, außerhalb der Hoheitsgewässer oder in Zollausschlussgebieten wie etwa Freihäfen verkauft und eingekauft werden. Innerhalb der EU ist der zollfreie Einkauf auf Flughäfen und in Flugzeugen zum 1.7. 1999 entfallen, da es keine Zollschranken mehr gibt. EU-Bürger dürfen bei der Rückreise von Ländern außerhalb der EU ins Heimatland u. a. ...
Read More »Fifo-Methode und Finanzausgleich – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe
Fifo-Methode, für First in first out Methode der Bewertung gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens. Die Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens, die im Jahresendbestand erfasst werden, sind im Lauf des Jahres i. d. R. zu unterschiedlichen Preisen erworben oder hergestellt worden. Das führt zu dem Problem der Bewertung am Bilanzstichtag. Die F.-M. geht davon aus, dass die zuerst erworbenen Wirtschaftsgüter auch zuerst verbraucht oder weiter veräußert werden. Der Endbestand wird also mit den Anschaffungskosten ...
Read More »Entscheidend geändert, Engelsches Gesetz und Einteignung – und die Bedeutung davon – Wirtschaftsbegriffe Übersicht
Entscheidend geändert Seit der Auflösung der Absatzmonopole 1999 müssen die Energieversorgungsunternehmen Wettbewerbspreise kalkulieren. Die positiven Folgen der Wettbewerbsbedingungen waren Preissenkungen bei Industriestrom und bei Haushaltsstrom. Eine solche Entwicklung wird in Zukunft für den gesamten europäischen Strom- bzw. Energiemarkt erwartet. Die E. wird dann zunehmend von Bedingungen auf dem europäischen Energiemarkt beeinflusst. In Österreich ist die Situation ähnlich wie in Deutschland. In der Schweiz hat die Energiegewinnung aus Wasserkraft traditionell ein ...
Read More »Dosenpfand – und die Bedeutung davon – Wirtschaftsbegriffe Übersicht
Dosenpfand umgangssprachliche Bezeichnung für ein Pfand, das seit dem 2003 in Deutschland auf Einweg-verpackungen (Dosen, Plastik- und Glasflaschen) von Bier, Mineralwasser und kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken erhoben wird. Spirituosen- und Weinmischgetränke sind von der Pfandpflicht ausgenommen. Durch das Pfand sollen die Wiedereinspeisung von Getränkeverpackungen in den Materialkreislauf gefördert und das Verpackungsmüllaufkommen reduziert werden. Die Pflicht zur Pfanderhebung und zur Pfanderstattung bei Rückgabe der leeren Verpackung erstreckt sich auf die gesamte Handelskette vom ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen