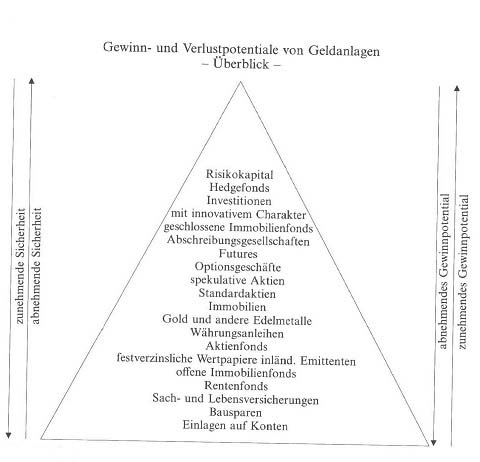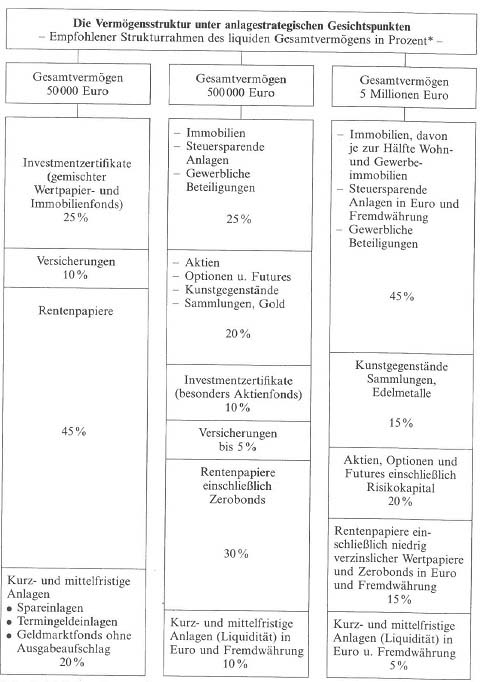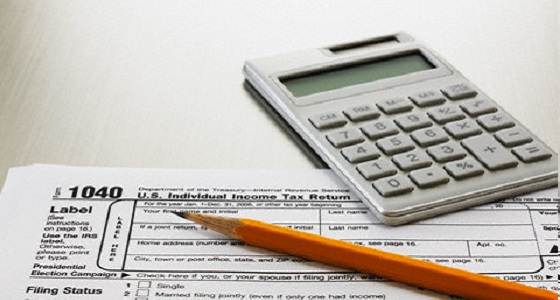Sparvertrag mit einmaliger oder laufender Einzahlung über einen Zeitraum bis zu 25 Jahren verknüpft mit einer Risikolebensversicherung. Im Falle des Todes des Sparers während der Laufzeit des Sparvertrages übernimmt die Versicherungsgesellschaft die Zahlung der fehlenden Sparleistungen und ermöglicht damit die Auszahlung der vereinbarten Vertragssumme. Der Versicherungsvertrag wird mit einer Versicherungsgesellschaft (nicht mit dem Kreditinstitut!) abgeschlossen. Die Höhe der Versicherungsprämien berechnet sich nach der Versicherungssumme und dem Lebensalter des Sparers.
Gewinn-/Lossparen
Sparvertrag mit betragsmäßig festgelegten Sparraten. Je nach Höhe der (Spar-) Raten erwirbt der Sparer monatlich ein oder mehrere Sparlos(e). Diese Sparlose bestehen aus einer Sparmarke und einem Gewinnlos. Die Sparmarken werden auf eine Sparkarte geklebt. Wenn die Sparkarte voll ist, kann der Sparer den damit ausgewiesenen Betrag einem Sparkonto gutschreiben oder sich auszahlen lassen. Mit den Gewinnlosen nimmt der Sparer an in der Regel monatlichen oder auch vierteljährlichen lotteriemäßigen Auslosungen teil.
Sparpläne
Sparverträge mit einmaligen oder regelmäßigen Sparleistungen zur Anlage in unterschiedlichen (Spar-)Formen, wie insbesondere Konten- und Wertpapiersparen. Den individuellen Wünschen und Anlagezielen der Sparer hinsichtlich Sicherheit, Rentabilität, Liquidität et cetera kann durch beliebige Kombination und Gewichtung der Sparformen entsprochen werden. Die Erträge der Anlage werden in der Regel nicht ausgeschüttet, sondern wieder angelegt.
Sparvertrag nach § 8 Fünftes Vermögensbildungsgesetz
Sparvertrag, in dem sich ein Arbeitnehmer gegenüber einem Kreditinstitut verpflichtet, einmalig oder für die Dauer von sechs Jahren seit Vertragsabschluss laufend, mindestens aber einmal im Kalenderjahr, als Sparbeträge vermögenswirksame Leistungen (vom Arbeitgeber) einzahlen zu lassen oder andere Beträge einzuzahlen. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich des Weiteren bis zum Ablauf einer Frist von sieben Jahren (Sperrfrist) die eingezahlten vermögenswirksamen Leistungen bei dem Kreditinstitut festzulegen und die Rückzahlungsansprüche aus dem Vertrag weder abzutreten noch zu beleihen.
Sparvertrag nach § 4 Fünftes Vermögensbildungsgesetz
Sparvertrag, in dem sich ein Arbeitnehmer gegenüber einem Kreditinstitut verpflichtet, einmalig oder für die Dauer von sechs Jahren seit Vertragsabschluss laufend vermögenswirksame Leistungen zum Erwerb von Beteiligungspapieren oder zur Begründung oder zum Erwerb von Beteiligungsrechten (vom Arbeitgeber) ein- zahlen zu lassen oder andere Beträge einzuzahlen. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich des Weiteren, dass die mit den Leistungen erworbenen Wertpapiere unverzüglich nach ihrem Erwerb bis zum Ablauf einer Frist von sieben Jahren (Sperrfrist) festgelegt werden und über die Wertpapiere oder die mit den Leistungen begründeten oder erworbenen Rechte bis zum Ablauf der Sperrfrist nicht durch Rückzahlung, Abtretung, Beleihung oder in anderer Weise verfügt wird.
Euribor-Sparen
Das sogenannte Euribor-Sparen repräsentiert eine recht attraktive Innovation im Geldanlagesektor. Nicht anders als beim gewöhnlichen Kontensparen werden Spargelder mit Kündigungsfristen (von in der Regel 1-3 Jahren) angelegt. Allerdings sind die Anlagesummen relativ hoch, je nach Bank zwischen 5000 und 25 000 Euro. Außerdem bieten nur einige wenige Banken diese Sondersparformen an. Die Verzinsung dieser Anlagen orientiert sich am Euribor. Dieser Referenzzinssatz errechnet sich aus den von den Euribor-Referenzbanken täglich um 11 Uhr Brüsseler-Zeit (MEZ) für Ein- bis Zwölfmonatsgelder im Interbankhandel in der Eurozone an den Informationsanbieter Moneyline Telerate gemeldeten Briefsätzen. Dem Kreis der Euribor-Referenzbanken gehören an: insgesamt 47 Banken aus den Euro-Ländern (darunter 12 aus Deutschland), 4 Banken aus den übrigen EU-Ländern sowie 6 Banken aus Nicht-EU-Ländern. Der Euribor wird täglich (außer am Wochenende, am 1. Januar u. am 1. Weihnachtsfeiertag) nach der sogenannten Eurozinsmethode ermittelt und veröffentlicht. Um Ausreißer zu neutralisieren, werden die höchsten und die niedrigsten 15v.H. der Werte nicht in die Ermittlung einbezogen.
Der Euribor gilt als Benchmark (Orientierungsgröße) für die Zinssätze variabel verzinslicher Kredite, Anleihen und Einlagen sowie die von diesen Produkten abgeleiteten Finanzderivate.
Der dem jeweiligen Sparvertrag zugrunde gelegte Zinssatz wird entweder zu – zwischen der jeweiligen Bank und dem Anleger – vereinbarten Kündigungsfristen (z. B. vierteljährlich) oder zu ebenfalls vereinbarten festen Terminen (z. B. sechsmal im Jahr) dem jeweils geltenden Euribor angepasst. Zwischen diesen Zinsanpassungsterminen bleibt der Zinssatz unverändert. Um das mit dieser Zinsregelung verbundene (Anleger-)Risiko eines drastischen Zinsabfalls zu begrenzen, wird von manchen Banken ein Mindestzinssatz (floor) garantiert.
Unter Einschluss dieser (Zins-)Risikobegrenzung ist das Euribor-Sparen weitaus günstiger als die normale Geldanlage auf Sparkonten (Sparbuch). In der Regel übersteigt die Rentabilität des Euribor-Sparens auch die von Termingeldern.
Geldmarktfonds
Seit dem Aug.1994 lässt das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften die in anderen europäischen Ländern wie auch den USA schon längst eingeführten Geldmarktfonds zu. Geldmarktfonds sind mittlerweile von allen großen Fondsgesellschaften (Kapitalanlagegesellschaften) gehaltene Investmentfonds, die die bei ihnen eingezahlten Gelder am Geldmarkt1 anlegen. Solche Anlagen umfassen: kurzfristige Einlagen bei Kreditinstituten, Anleihen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, Anleihen, deren Zinsen sich variabel nach dem Geldmarktsatz richten (Floater), kurzfristige Schuldscheindarlehen wie auch Depositenzertifikate. Da am Inlands- wie auch am Eurogeldmarkt in der Regel nur sehr hohe Summen gehandelt werden, investieren die Fondsgesellschaften die mehr oder weniger großen respektive kleinen Anlagebeträge der Sparer zu den attraktiven Bedingungen von Großanlegern. Die meisten Fondsgesellschaften verlangen von den Anlegern Mindestanlagebeträge von 5000 bis 10000 Euro. Unter Ausnutzung der vorgenannten Marktvorteile liegen die Geldmarktfondsrenditen meist über den für Einlagen erzielbaren. Allerdings dürfen mit dieser Feststellung nicht die Kursschwankungen des Fonds wie auch die von diesem regelmäßig in Ansatz gebrachten Gebühren außer 8 gelassen werden. Die meisten Fondsgesellschaften verzichten auf einen Ausgabeaufschlag.
Bei einem Großteil der Geldmarktfonds werden die Erträge einbehalten und wieder angelegt (thesauriert), sodass die Kurse der Anteile fortlaufend steigen. Insgesamt lassen sich Geldmarktfondsanteile wie folgt beurteilen: Die uneingeschränkte Verfügbarkeit garantiert höchste Liquidität; das Anlagerisiko ist sehr gering; die Rendite ist relativ attraktiv.
In dieser Ausstattung können Geldmarktfondsanteile als eine echte Alternative zu Festgeldern oder Spareinlagen gelten. Darüber hinaus eignen sie sich als vorläufige Anlagemöglichkeit („Parkmöglichkeit“), wenn der Anleger sich noch nicht längerfristig engagieren oder ein vorübergehendes Liquiditätspolster mit jederzeitiger Verfügbarkeit halten möchte.