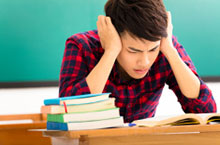Nutzen Erfahren Sie, dass nur die internale Konsequenzerwartung eine selbstreflexive Kognition ist. Kontrollüberzeugung Der Begriff der Kontrollüberzcugung bzw. Kontrollerwartung (Locus of control ol reinforcement) wurde von Rotter im Rahmen seiner sozialen Lerntheorie eingeführt und bezeichnet die generalisierte Erwartungshaltung eines Individuums, ob es durch eigenes Verhalten wichtige Ereignisse herbeiführen kann (internale Kontrolle) oder ob die Konsequenzen seines Verhaltens außerhalb seiner Einflussmöglichkeit (externale Kontrolle) liegen (vgl. Rotter 1966). 3 Dimensionen Levenson erweiterte ...
Read More »Tag Archives: gute lernmethoden
Auswirkungen der Gedanken auf die Psyche und Interaktion – Strategien für erfolgreich lernen
Nutzen Erfahren Sie, welche Auswirkungen Gedanken auf psychische Prozesse wie Konzentration, Stimmung und Gefühle haben. Übung Nehmen Sie sich bitte 10-15 Minuten Zeit. Versetzen Sie sich in Ihre Schulzeit zurück. Dann fällt Ihnen vermutlich schnell eine Situation ein, in der Sie eine schlechte Schulnote bekommen haben. Die meisten Menschen haben die eine oder andere Klausur mit einer schlechten Note abgeschlossen und entwickelten in diesem Zusammenhang eine Reihe negativer Gefühle. Ist ...
Read More »Selbstwirksamkeit ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Prüfung und Vorbereitung – erfolgreich lernen
Wirkung eigener Gedanken Nicht die Tatsachen selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen darüber. Epiktet (Epiktet 1958). Mit diesem Satz beschreibt der griechische Philosoph Epiktet (um 55- 140 n. Chr.), dass das menschliche Verhalten in entscheidendem Maße von den eigenen Gedanken geprägt wird. Für Ihre Prüfungssituation bedeutet das, dass Ihre Gedanken mit darüber entscheiden, wie Sie sich in der ganzen Prüfungsphase fühlen und welche Note Sie schließlich erzielen. In diesem ...
Read More »Quellen und Folgen der Selbstwirksamkeit – Strategien für erfolgreich lernen
Nutzen Lernen Sie die Ursachen der Selbstwirksamkeit kennen und machen Sie sich klar, weiche Bereiche davon beeinflusst werden. Eigene Erstellung nach Bandura 1977 und 1997 Quellen Bandura unterscheidet vier Quellen, die in unterschiedlicher Weise die Entwicklung der Selbstwirksamkeit als eine erlernte kognitive Überzeugung fördern. Welchen Einfluss diese Quellen entfalten hangt davon ab, wie die erhaltenen Informationen selektiert, interpretiert und in das Überzeugungssystem integriert werden. Unterschiede in der Selbstwirksamkeit zweier Personen, ...
Read More »Effektives Mitschreiben ist die beste Vorbereitung für eine Prüfung – erfolgreich lernen
Das kennen Sie bestimmt auch: Sie besuchen die Vorlesungen regelmäßig (mit religiösem Eifer, könnte man sagen), geben sich aber Mühe, so weil wie möglich vom Vortragenden weg zu sitzen (es ist nicht gut, die Aufmerksamkeit unverstandener, aber mächtiger Kräfte zu erregen) und schreiben vollständig mit. Manche Vortragende liefern dafür Vorlagen in solchem Tempo (oft mit der Hilfe des technologischen Äquivalents einer tibetanischen Gebetsmühle – einem Overheadprojektor), dass die Gemeinde voll ...
Read More »Auswirkungen der Gedanken auf den Körper – Strategien für erfolgreich lernen
Nutzen Spüren Sie die Macht der Gedanken in Ihrem Körper. Um die Auswirkungen der Gedanken auf den Körper etwas näher kennenzulernen, versetzen Sie sich bitte in die folgende Situation (lesen Sie hierfür die Sätze langsam durch und lassen Sie die inneren Bilder auf sich wirken): Übung 1 Sie kommen gerade nach Hause, nachdem Sie auf dem Markt eingekauft haben. Dort haben Sie bei Ihrem Gemüsehändler zwei Zitronen erworben, weil Sie ...
Read More »Beachten Sie wichtige Regeln beim Mitschreiben in der Vorlesung – Strategien für erfolgreich lernen
Nutzen Merken Sie sich die folgenden Regeln für Ihre Mitschriften und Sie werden wesentlich mehr mit Ihren Aufzeichnungen anfangen können. Regeln ■ Strukturieren Sie das Gehörte. Wenn Ihnen der Aufbau und die Gliederung des Stoffs bekannt sind, wirkt diese Struktur wie ein Gerüst, dessen Lücken Sie mit Ihren Notizen füllen können. Nutzen Sie kommentierte Vorlesungsverzeichnisse und bereiten Sie sich auf den Besuch einer Vorlesung vor. ■ Hören Sie aktiv zu. ...
Read More »Die perfekte Struktur für Ihre Mitschrift in der Vorlesung – Strategien für erfolgreich lernen
Nutzen Sie ein gut strukturiertes Mitschriftenblatt. Beispiel Rand zum Abheften Name der Veranstaltung: BWL I Titel der Vorlesung: Controlling Datum 15.5.07 Seite 8 Dozent; Heister Rand für Anmerkungen, Notizen, Kommentare, Markierungen. Def. Überleitung zur letzten Veranstaltung: Thema/Thesen/Fragen: Differenzierung strategisches und operatives Controlling Inhalte der Veranstaltung – gut leserlich P. 3. strateg. Controlling Ziele Struktur… Lücken, um in der Nacharbeit Infos einfügen zu können Instrumente des strateg. Controllings SWOT ...
Read More »Erkennen Sie die Struktur der Vorlesung – Strategien für erfolgreich lernen
Nutzen Lernen Sie den Aufbau einer Vorlesung verstehen, dann können Sie die wesentlichen Aspekte besser erfassen. Dieses Artikel soll Sie von dem oft noch aus der Schule vertrauten Abpinnen von Folien oder von der Tafel wegführen. Wenn Sie den Aufbau einer Vorlesung durchschauen, erkennen Sie die wichtigen Punkte und können sich auf den Stoff der Vorlesungen selbst konzentrieren. Erkennungssignale Für die Gliederung, also die Struktur einer Vorlesung gibt es sprachliche ...
Read More »Veränderung der Gedanken Teil I – Strategien für erfolgreich lernen
Nutzen Sie lernen Techniken kennen, mit denen Sie Ihre Gedanken so verändern können, dass Sie Ihr Prüfungsziel erreichen. Mithilfe der Fragebogenanalyse im vorigen Artikel haben Sie nun erkannt, welche Gedanken Ihnen bei der Bewältigung der Prüfung im Wege stehen. Hier werden Sie nun über Techniken und Methoden informiert, mit denen sich negative Gedanken verändern lassen. In der Kognitiven Verhaltenstherapie, die sich von allen Therapierichtungen am intensivsten mit der Veränderung von ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen