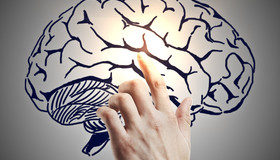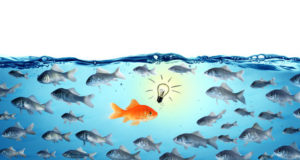Beruf die auf Ausbildung bzw. auf spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen gegründete, auf Dauer angelegte, sinnerfüllte innere Bindung einer Person an einen Kreis von Tätigkeiten aus der arbeitsteilig strukturierten Wirtschaft. Mit dem Beruf wird die Erwartung verbunden, als Arbeitnehmer ein dauerhaftes geregeltes Einkommen erzielen zu können. Im Unterschied dazu wird mit Job meist eine mehr oder weniger vorübergehende Erwerbstätigkeit bezeichnet. – Siehe auch Berufswahl. Berufliche Bildung der gesamte Bereich der ...
Read More »A B C
Beschaffung, Beschäftigung und Beschäftigungsförderungsgesetz – wichtige Wirtschaftsbegriffe
Beschaffung diejenigen Tätigkeiten eines Unternehmens, die darauf gerichtet sind, alle für die Leistungserstellung notwendigen Produktionsfaktoren zu erlangen und bereitzustellen. Im weiteren Sinn zählen zur B. Anlagegüter (Betriebsmittel), Material, Arbeitskräfte, Kapital, Dienstleistungen (Steuer- und Betriebsberatung, Schulung), Rechte, externe Informationen, im engeren Sinn Sachgüter (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Halbfabrikate) und Dienstleistungen (einschließlich Rechte und Informationen). In der Praxis werden die Begriffe B. und Einkauf gleichbedeutend verwendet, über die B. hinaus geht die ...
Read More »Bund der Steuerzahler, BdV und BA – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe
Bund der Steuerzahler private Einrichtung, die überparteilich und gemeinnützig die Interessen der Steuerzahler gegenüber dem Staat vertritt. Zu ihren Aufgaben zählt auch, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen Verwaltung anzumahnen und Fälle öffentlicher Verschwendung aufzuzeigen. Sitz des B.d.S. ist Wiesbaden. steuerzahler*de Bund der Versicherten BdV gemeinnütziger, 1982 gegründeter Verein, der v.a. Verbraucheraufklärung für alle Fragen des Versicherungswesens betreibt, u.a. durch Information sowie Beratung durch Juristen und Versicherungsberater. Daneben führt der ...
Read More »Anlagemotiv, Anlagevermögen und Anlegerschutz und was das bedeutet – wichtige Wirtschaftsbegriffe
Anlagemotiv Ein wichtiger Punkt bei der Anlageberatung ist die Auslotung des jeweiligen A. beim Kunden. Kreditinstitute sind verpflichtet, von ihren Kunden Angaben zu verlangen über ihre Erfahrungen oder Kenntnisse in Geschäften, die Gegenstand von Wertpapierdienst-leistungen sein sollen, über ihre mit den Geschäften verfolgten Ziele, ihre finanziellen Verhältnisse und ihre jeweilige Risikobereitschaft. Anlagevermögen alle Wirtschaftsgüter, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z.B. Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und ...
Read More »Bluechip, Boden und Bogen – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste
Bluechip amerikanischer Börsenaus-druck für die Aktien von besonders substanz- und ertragsstarken Unternehmen in Anlehnung an die blauen Jetons beim amerikanischen Pokerspiel und ein international gebräuchliches Synonym für die großen, populären Standardwerte des Aktienmarkts. Boden ein Produktionsfaktor neben Arbeit und Kapital. B. gilt wie Arbeit als ursprünglicher (originärer) Produktionsfaktor. Der Faktor B. umfasst die Erdoberfläche, die Bodenschätze als stand ortgebundene Rohstoffe, die naturgegebenen Energiequellen und das Klima. Die besondere Einkommensart, die ...
Read More »Assessment-Center, Asset Backed Security und Audit – und was das bedeutet – Wirtschaftsbegriffe Liste
Assessment-Center ein spezielles Auswahlverfahren für neue Mitarbeiter, das von größeren Unternehmen immer häufiger eingesetzt wird, um ein umfassendes Bild von den Bewerbern für eine Stelle zu erhalten. Nach einer Vorauswahl (Test) werden mehrere Bewerber gemeinsam zu einem Auswahlverfahren eingeladen; in mehrtägigen Veranstaltungen werden Fertigkeiten wie Sorgfalt, Teamfähigkeit, Kommunikations- und Kritikfähigkeit, Kreativität und Flexibilität in bestimmten gruppenbezogenen Aufgabenstellungen abverlangt, um den am besten geeigneten Bewerber herauszufinden. Asset Backed Security Abk. ABS: ...
Read More »Beteiligungsfinanzierung, Betrieb und Betriebliche Altersvorsorge – und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe
Beteiligungsfinanzierung Form der Außen- und Eigenfinanzierung, wobei Eigenkapital durch Geld- oder Sacheinlagen von Gesellschaftern eines Unternehmens beschafft wird; die Kapitalgeber werden Miteigentümer. Die B. erfolgt bei einer AG durch Ausgabe neuer Aktien, bei der GmbH durch Übernahme von Anteilen am Stammkapital, bei Personengesellschaften durch Einlagen der Gesellschafter. Betrieb eine organisierte Wirtschaftseinheit, die Güter bzw. Leistungen erstellt und auf Märkten anbietet. Unter dem Begriff Betrieb wird häufig die technisch-organisatorische Einheit verstanden, ...
Read More »Bewertung – und die Bedeutung davon – Wirtschaftsbegriffe Übersicht
Bewertung die Zuordnung einer Geldgröße zu bestimmten Gütern oder Handlungsalternativen. Die Wertansätze im Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und-Verlust-Rechnung) gründen sich gemäß handels- und steuerrechtlicher Vorschriften auf Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Teilwert und gemeinen Wert. Die Kostenrechnung legt den Tageswert zugrunde, um nicht Scheingewinne oder -Verluste auszuweisen, oder Verrechnungspreise. Bei der B. ganzer Unternehmen werden meist der Substanzwert und der Ertragswert herangezogen. Bewertungsgrundsätze dienen dazu, den gesetzlichen Regeln des HGB und der Abgabenordnung zu ...
Read More »Ausbildungsbeihilfe, Ausbildungsfreibetrag und Ausbildungsplatzabgabe und alles darüber – wichtige Wirtschaftsbegriffe
Ausbildungsbeihilfe von öffentlicher und privater Seite gezahlte Leistungen, die Personen in der Ausbildung fördern. Die bekanntesten öffentlichen Hilfen sind BAföG und Hilfen vom Arbeitsamt im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik. Private A. leisten Stiftungen wie die Studienstiftung des Deutschen Volkes, Stiftungen der Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände und der politischen Parteien. Ausbildungsfreibetrag Hat ein Steuerpflichtiger Kinder in Ausbildung, die nicht zu Hause wohnen und älter als 18 Jahre sind, kann ein Freibetrag in Anspruch ...
Read More »Beschäftigungsgrad, Beschäftigungspolitik und Beschäftigungsverbote – Wirtschaftsbegriffe Liste
Beschäftigungsgrad das Verhältnis von tatsächlicher Beschäftigung zur möglichen Beschäftigung bzw. Kapazitätsausnutzung als Prozentsatz: Beschäftigungsgrad in %: genutzte Kapazität x 100 / mögliche Kapazität Die theoretisch mögliche Kapazität (Beschäftigung zu 100%) ist nicht der wirtschaftlich optimalen Kapazität (z.B. Vollbeschäftigung bei 85%) gleichzusetzen. Gemessen wird die Beschäftigung in Produktionsmengen, Arbeits- oder Maschinenstunden. Beschäftigungspolitik der Einsatz von Maßnahmen der Wirtschaftspolitik, die das Ziel haben, Vollbeschäftigung zu erreichen. Unterschieden wird zwischen angebotsorientierter Beschäftigungspolitik (z.B. ...
Read More » Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen
Geld Anlegen 24h Ihr Geld Richtig und Sicher Anlegen